November 2025
Philosophie im Alltag IV: Stoizismus und Tantra. geht das zusammen?
Vom stoischen Gleichmut zum Nicht-Verweilen: Zwei Wege der Gelassenheit
In den letzten Artikeln haben wir uns mit der antiken Philosophie beschäftigt – mit der Dichotomie der Kontrolle, mit der Kunst des Loslassens durch Vernunft und Logik. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen und dir eine andere grosse Tradition vorstellen: den (tibetischen) Tantra, insbesondere die Lehren des Mahamudra ("grosses Siegel").
Diese beiden kulturell doch so unterschiedlichen Wege begleiten mich schon fast mein ganzes Leben. Mit 10 Jahren bekam ich von meinem Vater einen dicken Wälzer der Griechischen Sagen geschenkt, so kam ich nach und nach zu den griechischen Denkern. Mit 16 Jahren hat mich eine Atemtherapeutin in das Chakrensystem und Atemtechniken eingeführt. Einige Jahre später habe ich, durch verschiedene Schriften und Meditationstechniken, begonnen mich mit (Kaschmirischen) tantrischen Meditationen und Techniken zu beschäftigen. Read More…
In den letzten Artikeln haben wir uns mit der antiken Philosophie beschäftigt – mit der Dichotomie der Kontrolle, mit der Kunst des Loslassens durch Vernunft und Logik. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen und dir eine andere grosse Tradition vorstellen: den (tibetischen) Tantra, insbesondere die Lehren des Mahamudra ("grosses Siegel").
Diese beiden kulturell doch so unterschiedlichen Wege begleiten mich schon fast mein ganzes Leben. Mit 10 Jahren bekam ich von meinem Vater einen dicken Wälzer der Griechischen Sagen geschenkt, so kam ich nach und nach zu den griechischen Denkern. Mit 16 Jahren hat mich eine Atemtherapeutin in das Chakrensystem und Atemtechniken eingeführt. Einige Jahre später habe ich, durch verschiedene Schriften und Meditationstechniken, begonnen mich mit (Kaschmirischen) tantrischen Meditationen und Techniken zu beschäftigen. Read More…
Gefäßentzündungen verstehen – und was du ganzheitlich tun kannst
Gefäßentzündungen verstehen – und was du ganzheitlich tun kannst
Deine Gefäße brennen – aber du siehst und spürst kein Feuer. Gefäßentzündungen sind eine dieser stillen Bedrohungen, die sich über Jahre aufbauen können, ohne dass du zunächst etwas merkst. Vielleicht fühlst du dich einfach nur müde, aufgedunsen oder hast wiederkehrende Infekte. Aber was hat das mit deinen Blutgefäßen zu tun?
In meiner Praxis habe ich immer wieder Patienten, die unter chronischen Gefässentzündungen leiden. Und auch ich hatte vor wenigen Jahren eine autoimmune Gefässentzündung.
Daher: Lass uns gemeinsam einen Blick darauf werfen, wie Entzündungen in deinen Gefäßen entstehen – und vor allem: was du konkret dagegen tun kannst. Read More…
Deine Gefäße brennen – aber du siehst und spürst kein Feuer. Gefäßentzündungen sind eine dieser stillen Bedrohungen, die sich über Jahre aufbauen können, ohne dass du zunächst etwas merkst. Vielleicht fühlst du dich einfach nur müde, aufgedunsen oder hast wiederkehrende Infekte. Aber was hat das mit deinen Blutgefäßen zu tun?
In meiner Praxis habe ich immer wieder Patienten, die unter chronischen Gefässentzündungen leiden. Und auch ich hatte vor wenigen Jahren eine autoimmune Gefässentzündung.
Daher: Lass uns gemeinsam einen Blick darauf werfen, wie Entzündungen in deinen Gefäßen entstehen – und vor allem: was du konkret dagegen tun kannst. Read More…
Philosophie im Alltag III: Deine Innere Burg
Die Innere Burg: Dein unerschütterlicher Raum in stürmischen Zeiten

Stell dir vor, du stehst mitten in einem Sturm. Um dich herum wirbelt alles durcheinander – Menschen haben Erwartungen an dich, Nachrichten prasseln auf dich ein, Termine jagen sich, vielleicht kritisiert dich jemand unfair oder eine Krise erschüttert deinen Alltag.
Und mittendrin stehst du. Wie wäre es, wenn es in dir einen Ort gäbe, der von all dem unberührt bleibt? Einen Raum, in den kein Sturm der Außenwelt eindringen kann?
Die alten Stoiker – vor allem Seneca und Marc Aurel – nannten diesen Ort die "Innere Burg". Keine physische Festung aus Stein, sondern ein mentaler Raum, den niemand erobern kann außer dir selbst. Ein Refugium der Gelassenheit, das immer verfügbar ist, egal was draußen geschieht. Read More…
Weihnachtsferien
24/11/25 07:04 Filed in: Praxisorganisation

Foto
In einem Monat ist schon Heiligabend…
Daher möchte ich hier schon einmal auf die Weihnachtsferien hinweisen!
Die Praxis ist von 24.12.25 bis 11.01.26 geschlossen!
Auch in den Ferien ist natürlich eine Terminvergabe über Doctolib online möglich!
Philosophie für den Alltag II: Epiktet
Epiktet: Antike Weisheit für moderne Zeiten – Stoische Philosophie für deinen Alltag
Serie: Philosophie für den Alltag. Teil 2.

Stell dir vor, du lebst als Sklave im antiken Rom. Kein Besitz, keine Freiheit, dein Körper gehört einem anderen Menschen. Und ausgerechnet in dieser Situation entwickelst du eine Philosophie, die Menschen auch 2000 Jahre später hilft, mit Jobverlust, Beziehungskrisen und Ängsten umzugehen.
Das ist die Geschichte von Epiktet – einem der einflussreichsten stoischen Philosophen, dessen Lehren heute aktueller sind denn je. In meiner Praxis- und an mir selbst- erlebe ich täglich, wie Menschen unter dem Druck unserer Zeit leiden.
Die stoische Philosophie bietet hier einen praktischen, erdenden Gegenpol zu all den schnellen Lösungsversprechen. Read More…
Serie: Philosophie für den Alltag. Teil 2.

Stell dir vor, du lebst als Sklave im antiken Rom. Kein Besitz, keine Freiheit, dein Körper gehört einem anderen Menschen. Und ausgerechnet in dieser Situation entwickelst du eine Philosophie, die Menschen auch 2000 Jahre später hilft, mit Jobverlust, Beziehungskrisen und Ängsten umzugehen.
Das ist die Geschichte von Epiktet – einem der einflussreichsten stoischen Philosophen, dessen Lehren heute aktueller sind denn je. In meiner Praxis- und an mir selbst- erlebe ich täglich, wie Menschen unter dem Druck unserer Zeit leiden.
Die stoische Philosophie bietet hier einen praktischen, erdenden Gegenpol zu all den schnellen Lösungsversprechen. Read More…
Tod und Trauer: Ein Wegweiser durch die dunkelsten Momente
22/11/25 19:26 Filed in: Seele
Tod und Trauer: Ein Wegweiser durch die dunkelsten Momente

Der Tod gehört zum Leben – und doch fühlt er sich jedes Mal unfassbar an. Wenn du einen geliebten Menschen verlierst, bricht eine Welt zusammen. Die Trauer, die dann kommt, ist keine Krankheit, die du heilen musst. Sie ist die natürliche Antwort deiner Seele auf einen unwiederbringlichen Verlust.
In diesem Beitrag möchte ich dir Perspektiven und praktische Hilfen an die Hand geben, die dir durch diese schwere Zeit helfen können – von philosophischen Ansätzen über religiöse Trostquellen bis hin zu ganz konkreten Alltagstipps. Read More…

Der Tod gehört zum Leben – und doch fühlt er sich jedes Mal unfassbar an. Wenn du einen geliebten Menschen verlierst, bricht eine Welt zusammen. Die Trauer, die dann kommt, ist keine Krankheit, die du heilen musst. Sie ist die natürliche Antwort deiner Seele auf einen unwiederbringlichen Verlust.
In diesem Beitrag möchte ich dir Perspektiven und praktische Hilfen an die Hand geben, die dir durch diese schwere Zeit helfen können – von philosophischen Ansätzen über religiöse Trostquellen bis hin zu ganz konkreten Alltagstipps. Read More…
Heilsames Berühren. Heilbehandlungen
Heilsames Berühren: Was geschieht, wenn Hände aufgelegt werden

Eine Einführung in die Heilarbeit nach Harry Edwards, Tom Johanson und der NFSH-Tradition
Wenn Du zum ersten Mal von „geistigem Heilen" oder „Handauflegen" hörst, mögen Bilder von Wunderheilungen und dramatischen Momenten vor deinem inneren Auge entstehen. Vielleicht denkst Du an Menschen, die ihre Krücken wegwerfen oder von unheilbaren Krankheiten befreit werden. Doch die Realität der geistigen Heilbehandlung ist eine ganz andere – und in ihrer Tiefe weitaus faszinierender.
Dieses Wochenende hatte ich wieder einen schönen und berührenden Kurs mit unserer Heilerzirkel-Gruppe hier in Lörrach/Weil am Rhein, die in der Tradition von Harry Edwards und Tom Johanson Heilsames Berühren praktiziert. Aus diesem Anlass ist dieser Text entstanden. Read More…

Eine Einführung in die Heilarbeit nach Harry Edwards, Tom Johanson und der NFSH-Tradition
Wenn Du zum ersten Mal von „geistigem Heilen" oder „Handauflegen" hörst, mögen Bilder von Wunderheilungen und dramatischen Momenten vor deinem inneren Auge entstehen. Vielleicht denkst Du an Menschen, die ihre Krücken wegwerfen oder von unheilbaren Krankheiten befreit werden. Doch die Realität der geistigen Heilbehandlung ist eine ganz andere – und in ihrer Tiefe weitaus faszinierender.
Dieses Wochenende hatte ich wieder einen schönen und berührenden Kurs mit unserer Heilerzirkel-Gruppe hier in Lörrach/Weil am Rhein, die in der Tradition von Harry Edwards und Tom Johanson Heilsames Berühren praktiziert. Aus diesem Anlass ist dieser Text entstanden. Read More…
Endometriose - Schmerzen im ganzen Körper

Endometriose: Wenn unsichtbare Schmerzen dein Leben bestimmen
Du hast seit Jahren starke Regelschmerzen? Du bist während deiner Periode manchmal nicht in der Lage zu arbeiten oder dein normales Leben zu führen? Und vielleicht hat dir jemand gesagt, das sei "normal" – dass Frauen eben leiden müssen? Ich selbst habe dies immer wieder von Gynäkologen gehört. Eine Lösung hatten sie nie. In meiner Praxis in Lörrach habe ich sehr viele Frauen, die über teils schwere Symptome klagen.
Dieser Artikel ist für euch, liebe Frauen. Denn was du erlebst, könnte Endometriose sein – eine Erkrankung, die viel zu oft übersehen wird.
Read More…
Postbiotika: Die nächste Generation der Darmgesundheit

Postbiotika: Die nächste Generation der Darmgesundheit – Warum diese bioaktiven Substanzen revolutionieren, wie wir über Darmtherapie denken
Du hast sicher schon von Probiotika und Präbiotika gehört. Aber kennst du auch Postbiotika? Diese relativ neue Kategorie bioaktiver Substanzen erobert gerade die Welt der Darmgesundheit – und das aus gutem Grund.
Erst seit 2018 nimmt die Zahl der veröffentlichten wissenschaftlichen Studien über Postbiotika deutlich zu, und die Forschungsergebnisse sind vielversprechend. Lass uns gemeinsam eintauchen in die faszinierende Welt der Postbiotika und herausfinden, warum sie das Potenzial haben, die Art und Weise zu verändern, wie wir Darmgesundheit unterstützen. Read More…
FDA Meldung: Naturidentische Hormontherapie als unbedenklich eingestuft
FDA streicht Warnhinweise zu Hormontherapie – neues Kapitel für Frauengesundheit
Am 10. November 2025 hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA angekündigt, die bisherigen „Black-Box“-Warnhinweise bei Präparaten zur Menopausen-Hormontherapie (z. B. Estradiol) zu entfernen. Diese Warnhinweise warnten bislang vor einem erhöhten Risiko für Brustkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz.
Die FDA begründet den Schritt mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die zeigen, dass bei frühzeitigem Beginn der Hormontherapie – also innerhalb von zehn Jahren nach der Menopause bzw. vor dem 60. Lebensjahr – kein erhöhtes Krebs- oder Herzrisiko nachweisbar ist.
Die bisherigen Warnungen basierten auf älteren Daten, die heute als nicht mehr repräsentativ gelten.
Das bedeutet: Eine individuell abgestimmte Hormontherapie kann für viele Frauen sicher und gesundheitsfördernd sein, wenn sie richtig eingesetzt wird.
Bestehen bleibt lediglich die Vorsicht bei einer reinen Östrogentherapie (!) ohne Progesteron-Ausgleich bei intakter Gebärmutter. (Dies wird leider nach wie vor gemacht! Mit oft schlimmen Nebenwirkungen)
👉 In meiner Praxis berate ich dich gerne zu einer personalisierten, bioidentischen Hormontherapie, abgestimmt auf dein Alter, deine Symptome und deinen individuellen Risiken.
Ein Hormontest in Blut oder Speichel bietet hierzu eine Grundlage.
Am 10. November 2025 hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA angekündigt, die bisherigen „Black-Box“-Warnhinweise bei Präparaten zur Menopausen-Hormontherapie (z. B. Estradiol) zu entfernen. Diese Warnhinweise warnten bislang vor einem erhöhten Risiko für Brustkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz.
Die FDA begründet den Schritt mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die zeigen, dass bei frühzeitigem Beginn der Hormontherapie – also innerhalb von zehn Jahren nach der Menopause bzw. vor dem 60. Lebensjahr – kein erhöhtes Krebs- oder Herzrisiko nachweisbar ist.
Die bisherigen Warnungen basierten auf älteren Daten, die heute als nicht mehr repräsentativ gelten.
Das bedeutet: Eine individuell abgestimmte Hormontherapie kann für viele Frauen sicher und gesundheitsfördernd sein, wenn sie richtig eingesetzt wird.
Bestehen bleibt lediglich die Vorsicht bei einer reinen Östrogentherapie (!) ohne Progesteron-Ausgleich bei intakter Gebärmutter. (Dies wird leider nach wie vor gemacht! Mit oft schlimmen Nebenwirkungen)
👉 In meiner Praxis berate ich dich gerne zu einer personalisierten, bioidentischen Hormontherapie, abgestimmt auf dein Alter, deine Symptome und deinen individuellen Risiken.
Ein Hormontest in Blut oder Speichel bietet hierzu eine Grundlage.
Butyrat - Schlüsselmolekül für deinen Darm und deine Gesundheit

Butyrat: Ein Schlüsselmetabolit des Darmmikrobioms
Hast du schon einmal von Butyrat gehört? Wenn nicht, bist du damit nicht allein. Dabei ist diese kleine Substanz einer der wichtigsten Stoffwechselprodukte, die dein Darmmikrobiom produziert – und sie hat weitreichende Auswirkungen auf deine gesamte Gesundheit. In meine Naturheilpraxis in Lörrach kommen täglich Menschen mit Darmproblemen, und oft spielt ein Mangel an Butyrat eine zentrale Rolle. Read More…
Vortrag "Naturidentische Hormone" Naturheilverein
Liebe Besucherinnen meines gestrigen Vortrags!
Danke, dass ihr da wart, und so lange durchgehalten habt. :)
Wie ich gesagt habe, findet ihr einiges aus dem Vortrag auch hier auf meiner Webseite!
Entweder oben auf "Open" clicken, dann öffnet sich die Tag-Liste. Dort "Hormone", "Frauenheilkunde", "naturidentische Hormone", "bioidentische Hormone" anklicken. So erscheinen alle Beiträge zu den Themen.
Oder:
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Danke, dass ihr da wart, und so lange durchgehalten habt. :)
Wie ich gesagt habe, findet ihr einiges aus dem Vortrag auch hier auf meiner Webseite!
Entweder oben auf "Open" clicken, dann öffnet sich die Tag-Liste. Dort "Hormone", "Frauenheilkunde", "naturidentische Hormone", "bioidentische Hormone" anklicken. So erscheinen alle Beiträge zu den Themen.
Oder:
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Schlafapnoe bei Frauen. Die Übersehenen

Schlafapnoe bei Frauen: Die übersehene Schlafstörung
Du wachst morgens auf und fühlst dich wie gerädert? Trotz ausreichend Schlaf bist du tagsüber ständig müde und kannst dich kaum konzentrieren? Vielleicht erzählt dir dein Partner auch, dass du nachts schnarchen würdest – aber das passt doch gar nicht zu dir? Wenn du dich in diesen Zeilen wiedererkennst, könnte eine obstruktive Schlafapnoe dahinterstecken. Und hier kommt die schlechte Nachricht: Bei Frauen wird diese Erkrankung häufig jahrelang übersehen. Read More…
Wechseljahre, Bauchfett und Adrenal fatique (Nebennierenschwäche)

Warum die Nebennieren in den Wechseljahren über Bauchfett, Energie und Stimmung entscheiden
Viele Frauen in den Wechseljahren bekommen plötzlich ein Thema, das vorher nie da war:
Bauchfett – obwohl sie nicht mehr essen.
Erschöpfung – obwohl sie „eigentlich alles richtig machen“.
Schwankende Stimmung und Schlafprobleme – obwohl „körperlich doch alles okay“ sein sollte.
Wenn dir das vertraut vorkommt, liegt die Ursache sehr wahrscheinlich nicht in deiner Disziplin, nicht in deinem Essen und nicht in einem „schlechten Stoffwechsel“.
Der Schlüssel sitzt viel unscheinbarer im Körper:
In deinen Nebennieren. Read More…
SWR1 Leute: Richard David Precht zu Gast
Heute eine Empfehlung zum Anhören. Aus der Sendung Leute des SWR1 Radio.
Zu Gast: Richard David Precht, Philosoph und Schriftsteller.

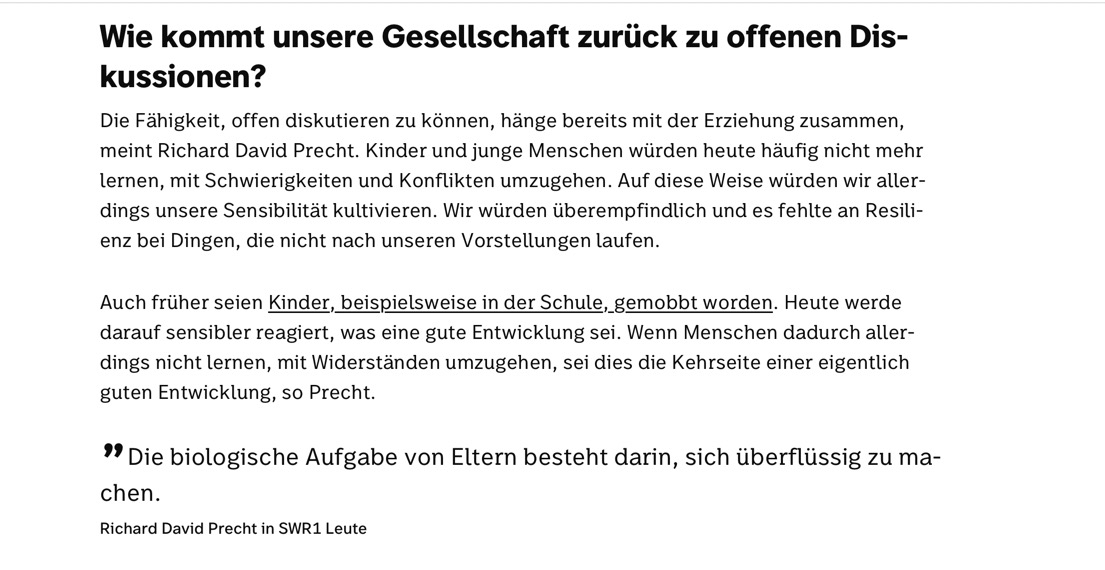
Zu Gast: Richard David Precht, Philosoph und Schriftsteller.

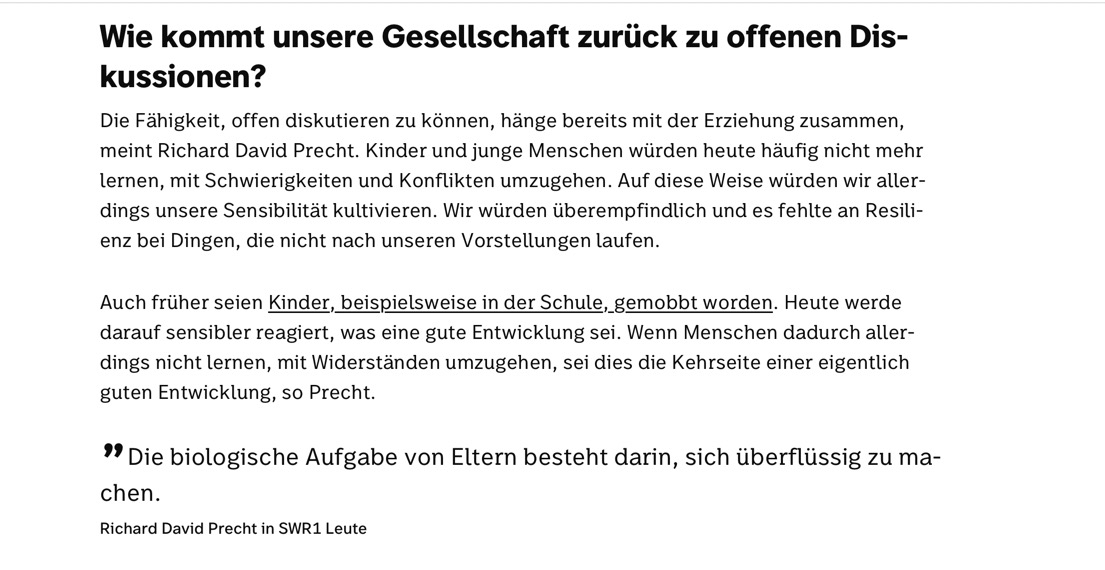
Darm- Hormone-Gefässe-Entzündungen
07/11/25 06:46 Filed in: Hormone | Darm | Mikrobiom | Entzündungen | Vegetatives Nervensystem | Gefässe

Dein Darm – die Steuerzentrale für Hormone, Stimmung und Entzündungen
Warum dein Bauchgefühl mehr ist als nur eine Redewendung
Hast du dich schon mal gefragt, warum du bei Stress Bauchschmerzen bekommst? Oder warum du dich nach bestimmten Mahlzeiten müde und niedergeschlagen fühlst? Die Antwort liegt tiefer als du denkst – genauer gesagt in deinem Darm.
Dein Darm ist weit mehr als ein simples Verdauungsorgan. Er ist ein hochkomplexes System, das eng mit deinem Gehirn, deinem Hormonsystem und deinem Immunsystem vernetzt ist. Lass mich dir zeigen, wie diese faszinierenden Zusammenhänge funktionieren und was das für deine Gesundheit bedeutet. Read More…
Philosophie für den Alltag I
Ich möchte von Zeit zu Zeit über Philosophie schreiben. Philosophie als Lebensweg, Ratgeber und Therapie. Ich beschäftige mich gerne mit den westlichen, antiken Philosophen.
Beginnen wir heute im antiken Griechenland: mit Heraklit (540-480 v. Chr).
Grundgedanken von Heraklit:
"Ich forsche in mir selbst". Ich vertraue meiner inneren Einsicht mehr als äusseren Autoritäten. Read More…
Beginnen wir heute im antiken Griechenland: mit Heraklit (540-480 v. Chr).
Grundgedanken von Heraklit:
"Ich forsche in mir selbst". Ich vertraue meiner inneren Einsicht mehr als äusseren Autoritäten. Read More…
Reiki zur Unterstützung in stressigen Zeiten

Reiki - Sanfte Unterstützung in stressigen Zeiten
Kennst du das Gefühl, wenn der Terminkalender überquillt, die To-do-Liste kein Ende nimmt und du abends erschöpft ins Bett fallen – nur um sich am nächsten Morgen genauso müde wieder aufzuraffen? Oder befindest du dich gerade in einer Lebensphase, in der alles zu viel wird? Wenn Körper und Seele nach einer Pause rufen, kann Reiki ein wertvoller Begleiter sein.
Was ist Reiki?
Reiki ist eine japanische Entspannungsmethode, die Anfang des 20. Jahrhunderts von Mikao Usui entwickelt wurde. Der Name setzt sich zusammen aus „Rei" (universell, spirituell) und „Ki" (Lebensenergie) – gemeinsam bedeutet es etwa „universelle Lebensenergie".
Read More…
Gelassen bleiben. Innere Ruhe finden
05/11/25 12:07 Filed in: Seele | Achtsamkeit
Kennst du das? Wenn die innere Unruhe nicht aufhört
Kommst du abends schwer runter? Fühlst du dich oft unter Strom, als würde dich etwas permanent antreiben – und du kannst einfach nicht abschalten? Du bist wie in einem Hamsterrad.
Natürlich spielt deine Persönlichkeit eine Rolle dabei, wie sehr dich solche Phasen belasten. Aber die gute Nachricht: Es gibt konkrete Wege, wie du deine Balance wiederfinden kannst.
Ich zeige dir ein paar praktische Ansätze, die dir helfen können, mehr Entspannung in deinen Tag zu holen.
Read More…
Kommst du abends schwer runter? Fühlst du dich oft unter Strom, als würde dich etwas permanent antreiben – und du kannst einfach nicht abschalten? Du bist wie in einem Hamsterrad.
Natürlich spielt deine Persönlichkeit eine Rolle dabei, wie sehr dich solche Phasen belasten. Aber die gute Nachricht: Es gibt konkrete Wege, wie du deine Balance wiederfinden kannst.
Ich zeige dir ein paar praktische Ansätze, die dir helfen können, mehr Entspannung in deinen Tag zu holen.
Read More…
Longevity. Ein Beitrag zu meinem Longevity Vortrag

Länger jung bleiben statt nur älter werden: Dein Wegweiser zu mehr Vitalität in jedem Alter
Stell dir vor, du bist 70 Jahre alt und fühlst dich wie 50. Kein Wunschdenken – die moderne Longevity-Forschung zeigt: Das ist möglich! Altern ist zwar unvermeidbar, aber wie du alterst, liegt größtenteils in deiner eigenen Hand.
In diesem ausführlichen Ratgeber erfährst du, wie du deine "Healthspan" – also deine gesunden, vitalen Lebensjahre – deutlich verlängern kannst. Wir verbinden dabei traditionelles Heilwissen mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und geben dir konkrete Strategien an die Hand, die du noch heute umsetzen kannst. Read More…
Reizdarm? Eine Verlegenheitsdiagnose?
01/11/25 10:25 Filed in: Mikrobiom | Hormome | Leaky gut | Histamin | SIBO | Nerven | Vegetatives Nervensystem | Darm
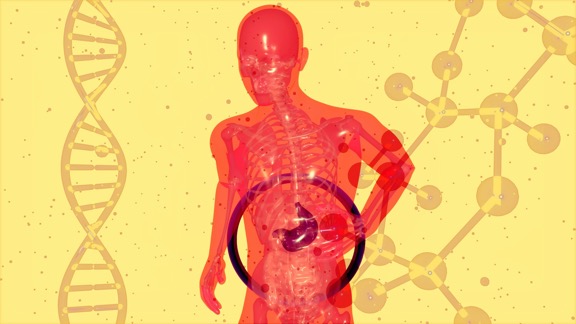
Reizdarm ist keine Erklärung – sondern oft eine Verlegenheitsdiagnose
„Sie haben Reizdarm.” Dieser Satz fällt in vielen Arztpraxen, auch hier in Lörrach, wenn Bauchschmerzen, Blähungen oder Durchfall nicht sofort einer klaren Ursache zugeordnet werden können. Für viele Betroffene fühlt sich diese Diagnose aber nicht wie eine Antwort an – sondern eher wie eine Sackgasse.
Du bist damit nicht allein. Und vor allem: Du musst dich nicht damit abfinden. Read More…
Meditation und Achtsamkeit: Ein Leitfaden für Einsteiger
Meditation und Achtsamkeit: Ein Leitfaden für Einsteiger
Heute zu Allerheiligen, einem Tag der Besinnung und dem Gedenken, möchte ich einen kurzen Beitrag zum Thema Innehalten und Meditation veröffentlichen. Ich selbst meditiere seit meiner Jugend. Aus der Not heraus. Mir ging es gesundheitlich, seelisch sehr schlecht. Meine Bio- Lehrerin hat mich an eine Atemtherapeutin (nach Prof. Ilse Middendorf) verwiesen, die mich in Atemtechniken eingelernt hat. Auch in die Lehre der Chakren und die Zusammenhänge von Atem-und Bewegung und dem vegetativen Nervensystem. Seit dort habe ich verschiedene Meditationstechniken erlernt, und wende sie regelmässig an. Read More…
Heute zu Allerheiligen, einem Tag der Besinnung und dem Gedenken, möchte ich einen kurzen Beitrag zum Thema Innehalten und Meditation veröffentlichen. Ich selbst meditiere seit meiner Jugend. Aus der Not heraus. Mir ging es gesundheitlich, seelisch sehr schlecht. Meine Bio- Lehrerin hat mich an eine Atemtherapeutin (nach Prof. Ilse Middendorf) verwiesen, die mich in Atemtechniken eingelernt hat. Auch in die Lehre der Chakren und die Zusammenhänge von Atem-und Bewegung und dem vegetativen Nervensystem. Seit dort habe ich verschiedene Meditationstechniken erlernt, und wende sie regelmässig an. Read More…