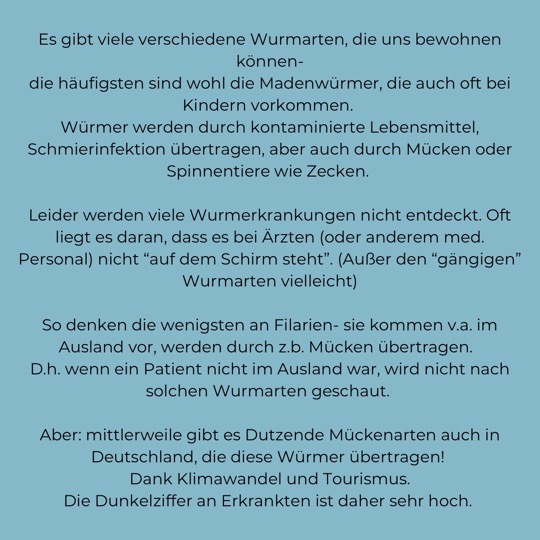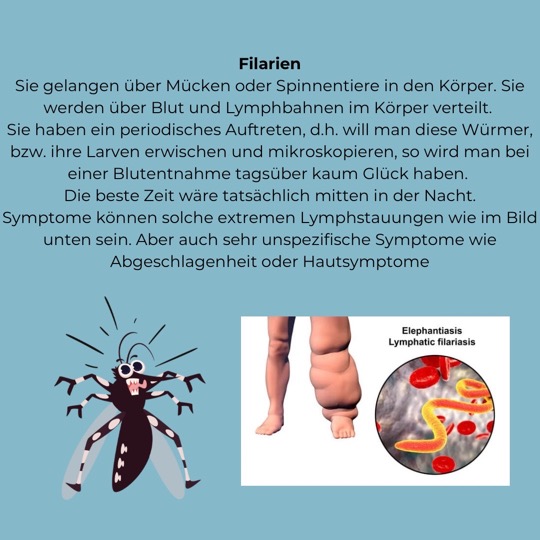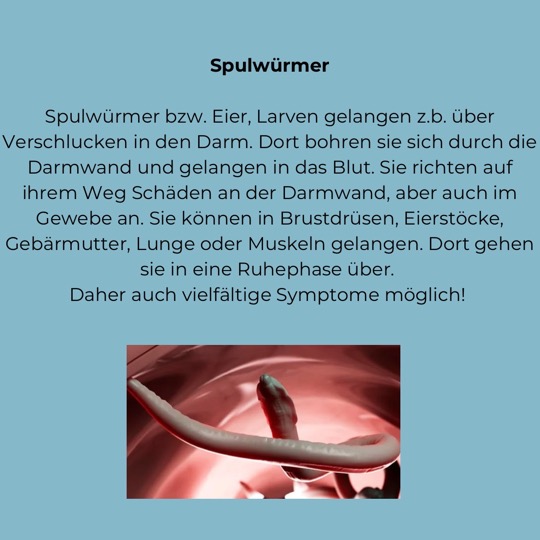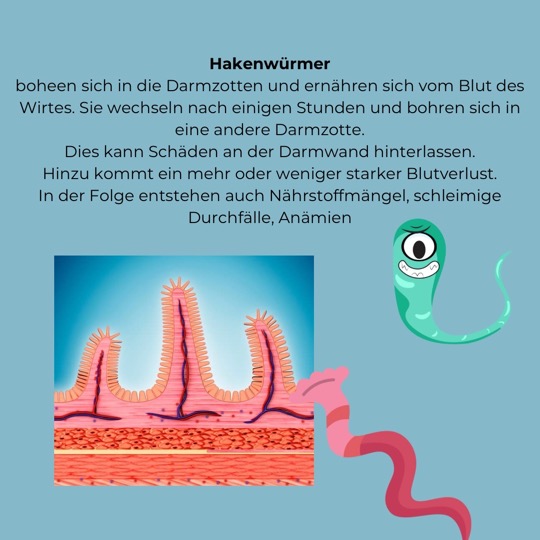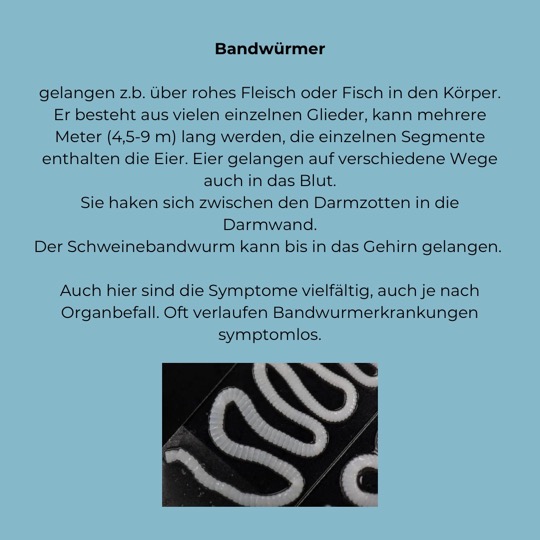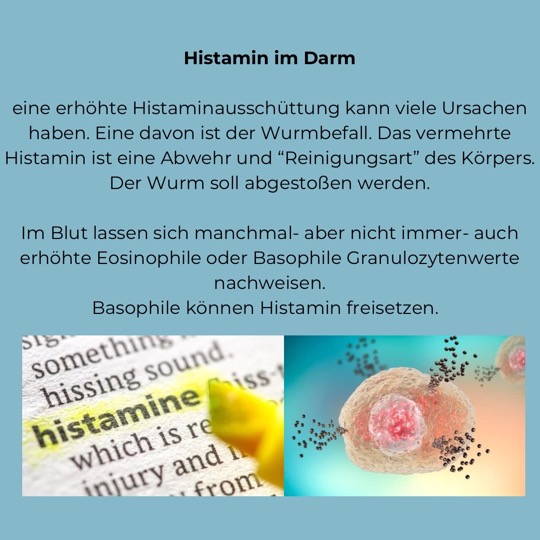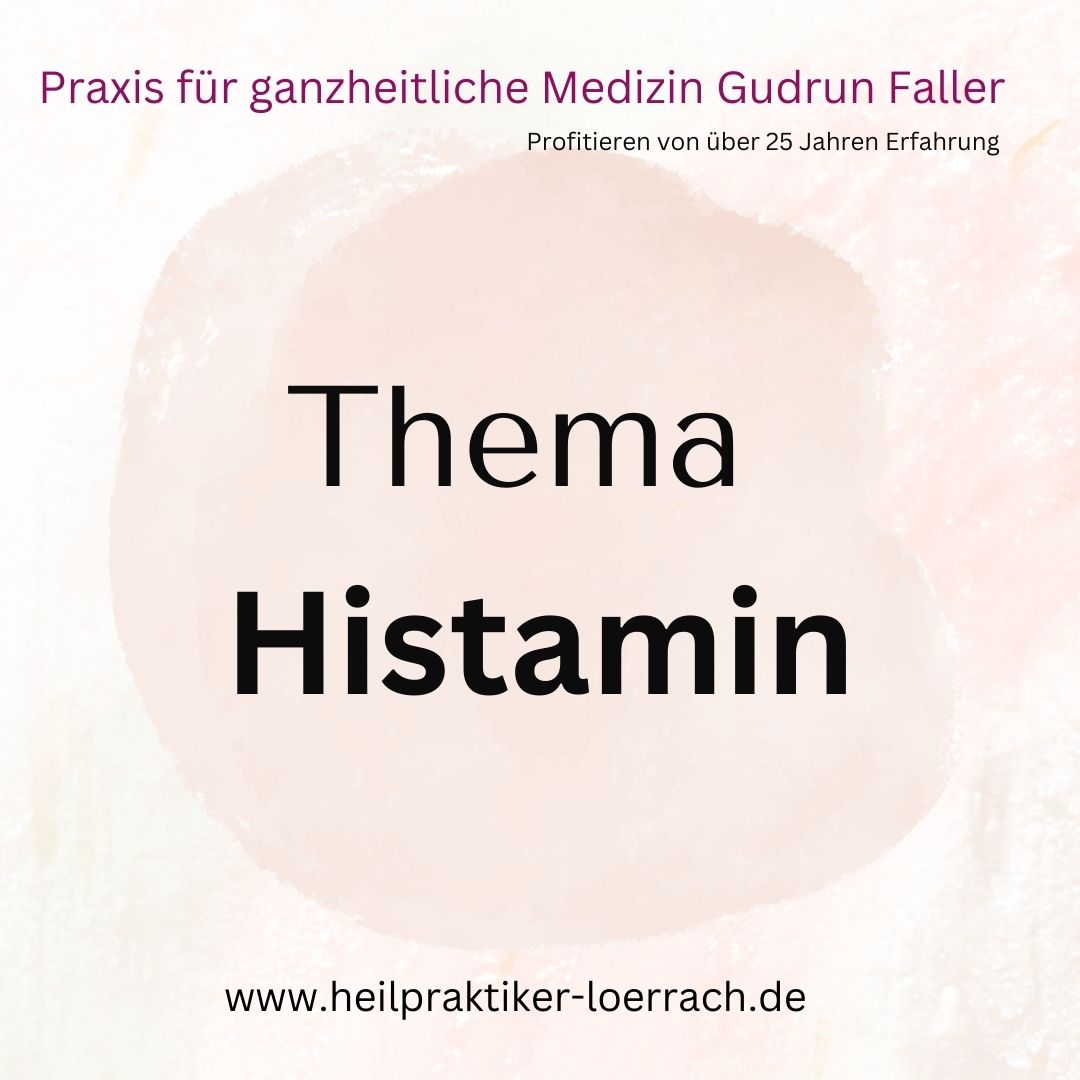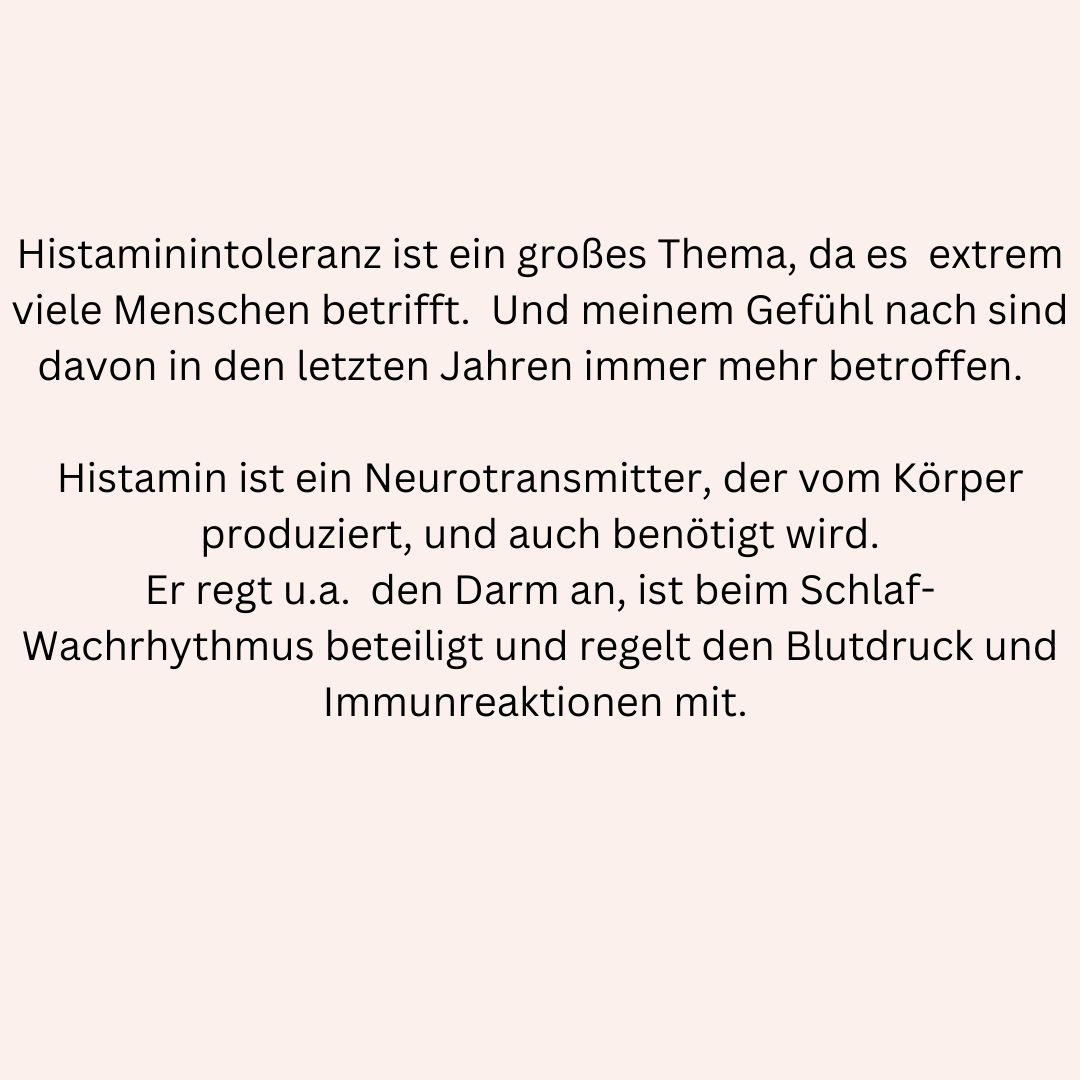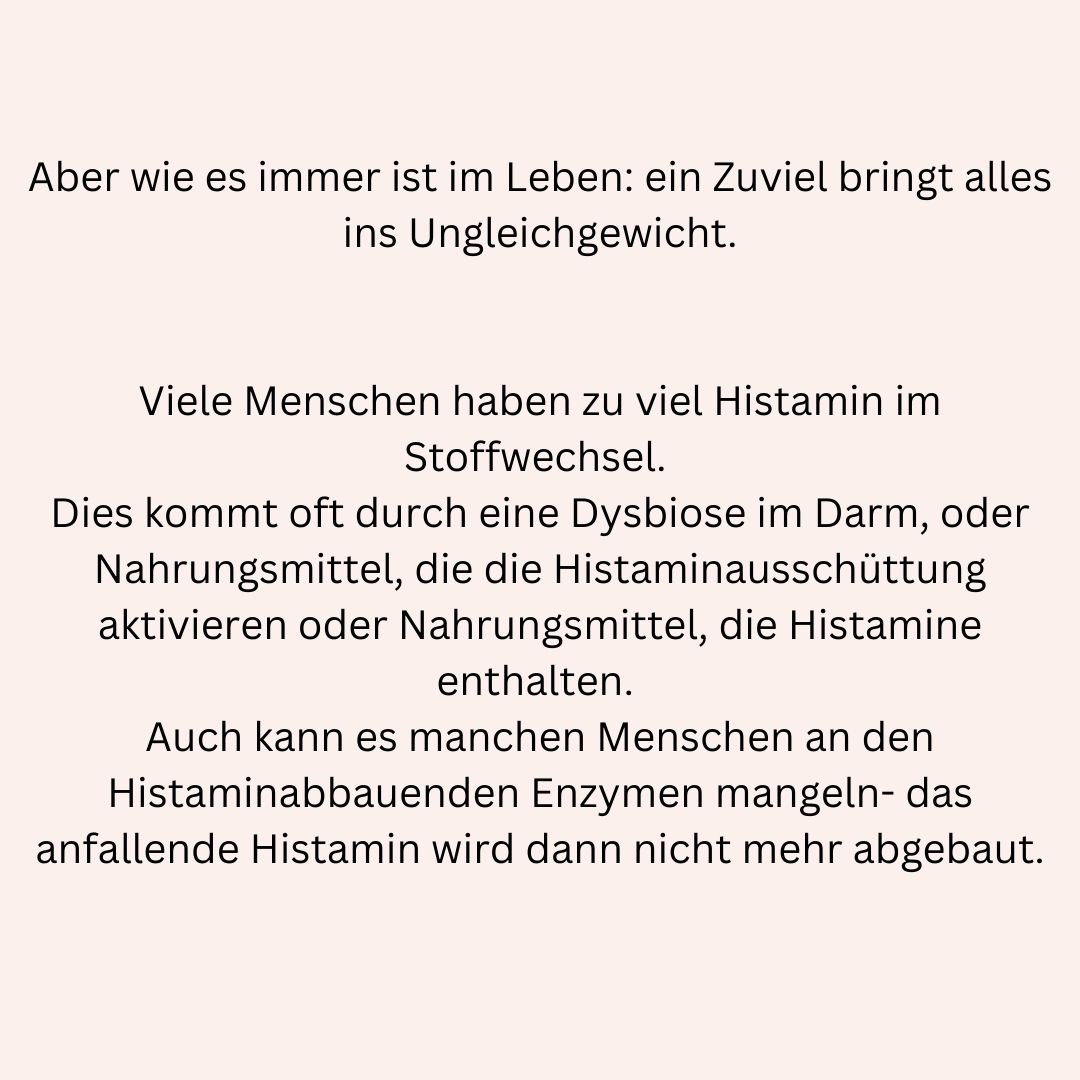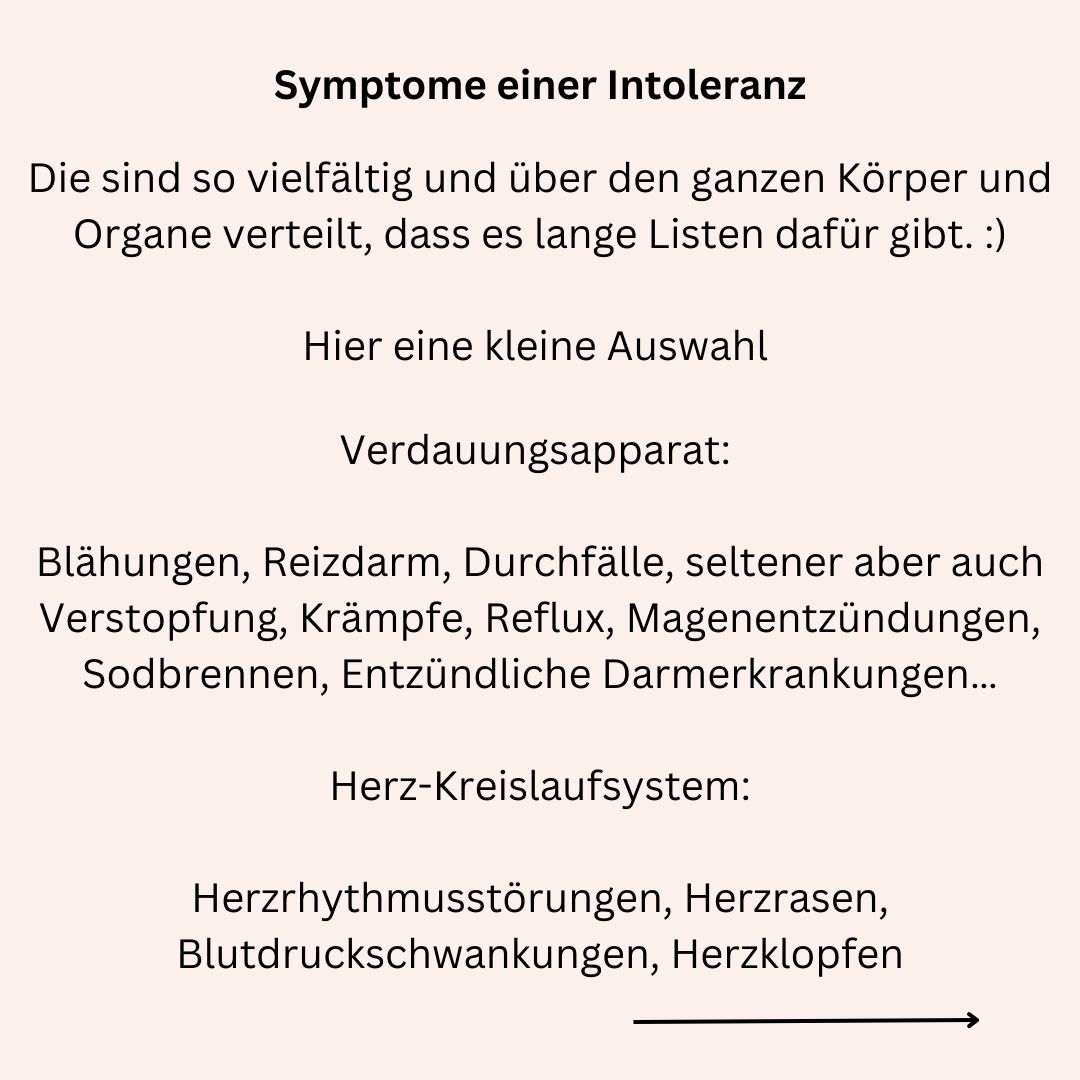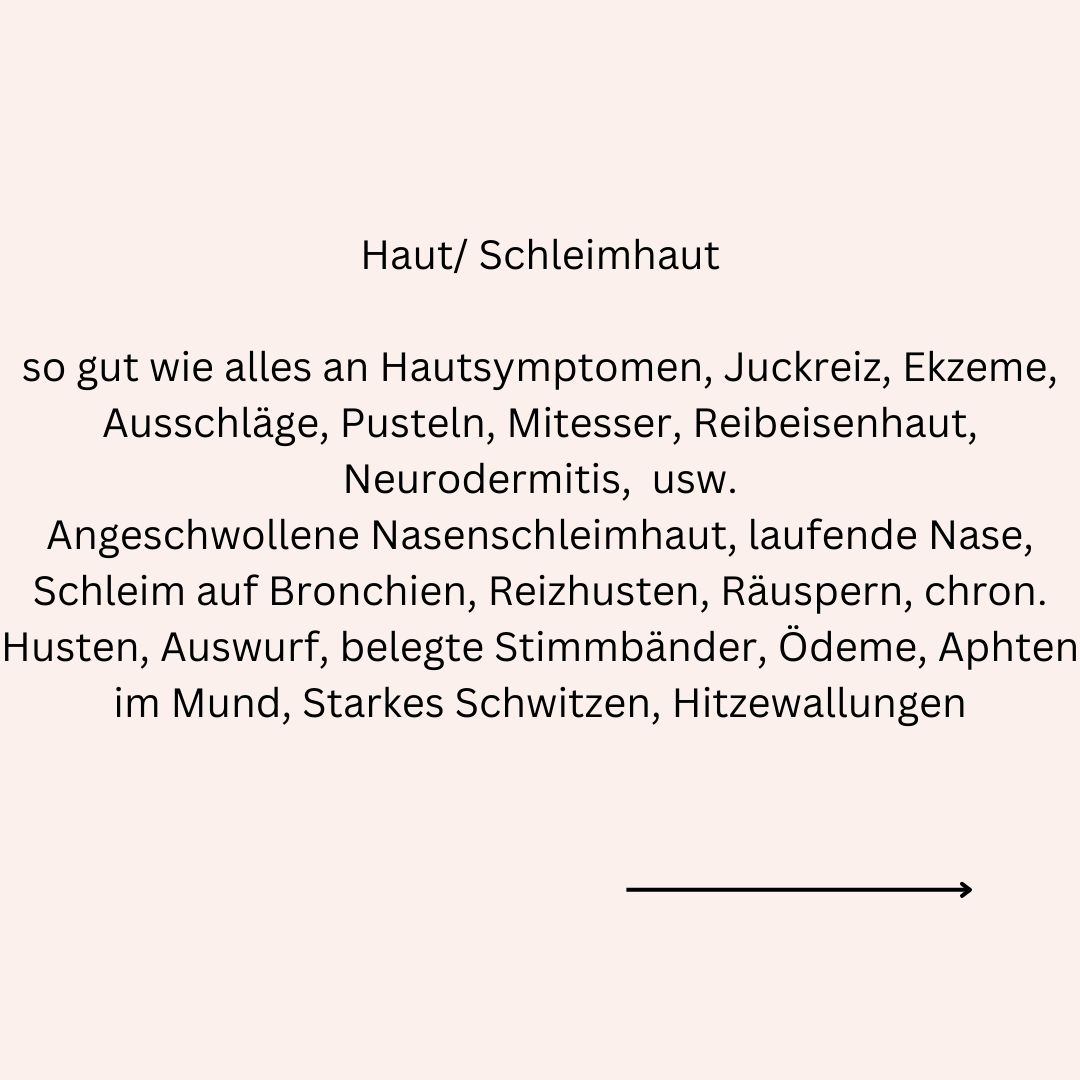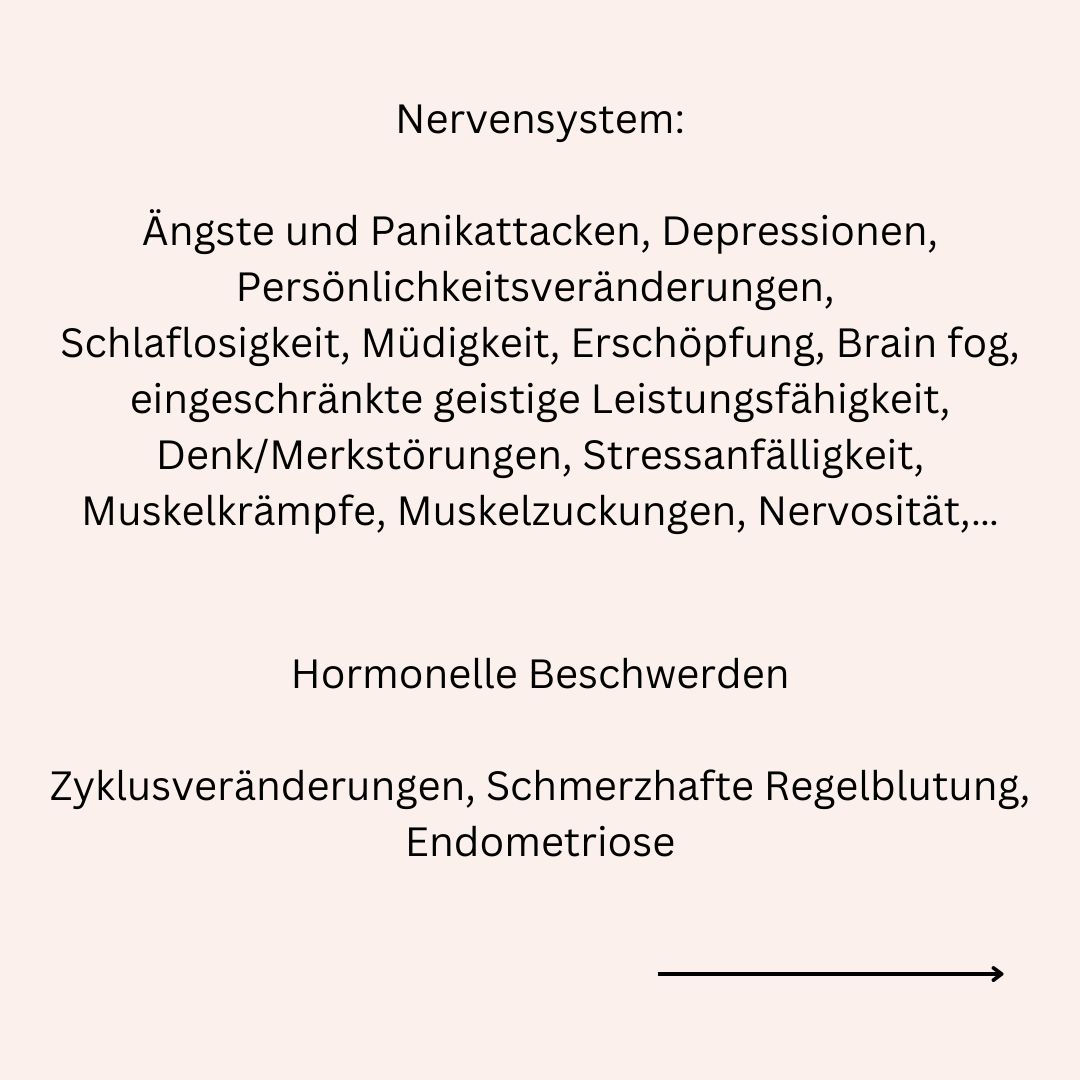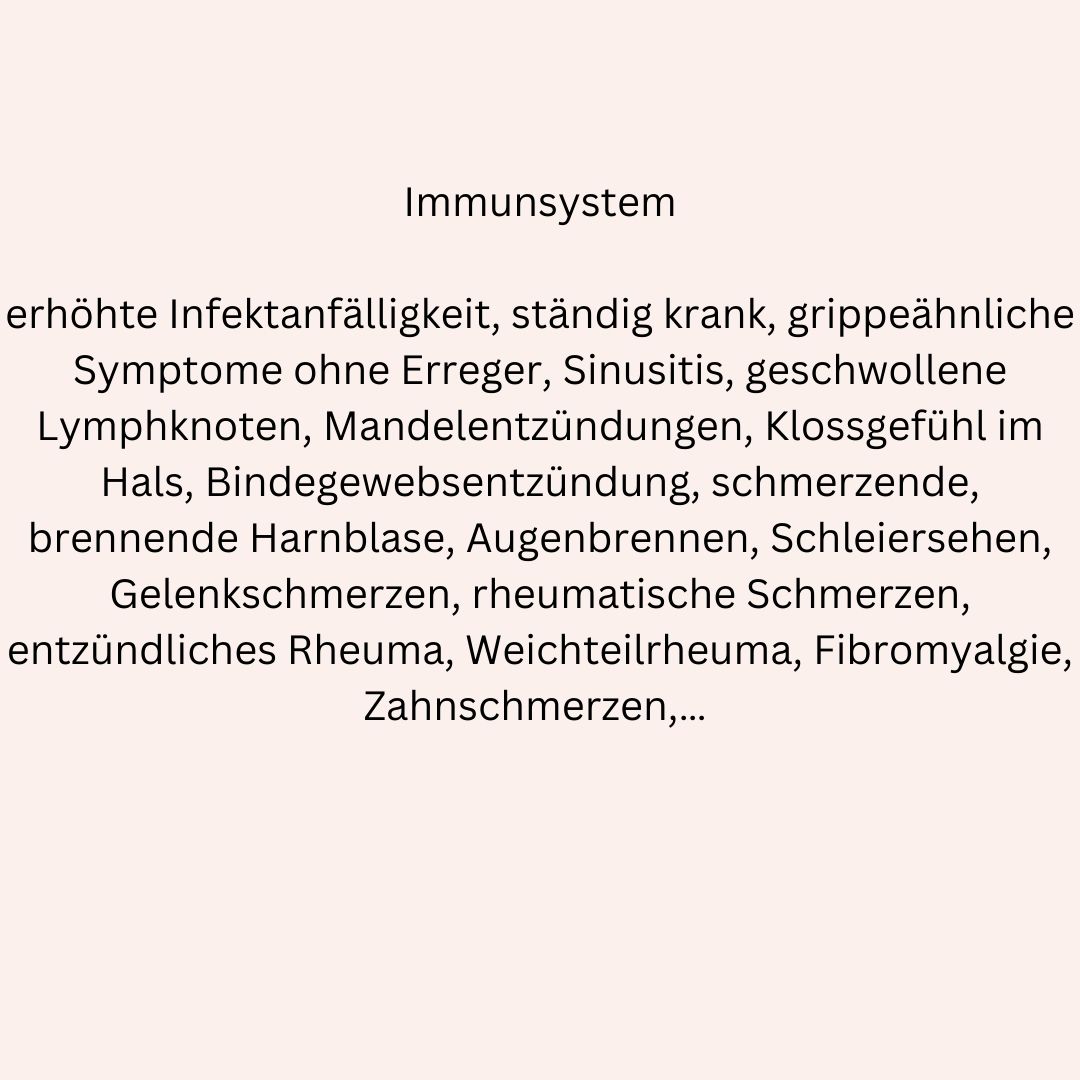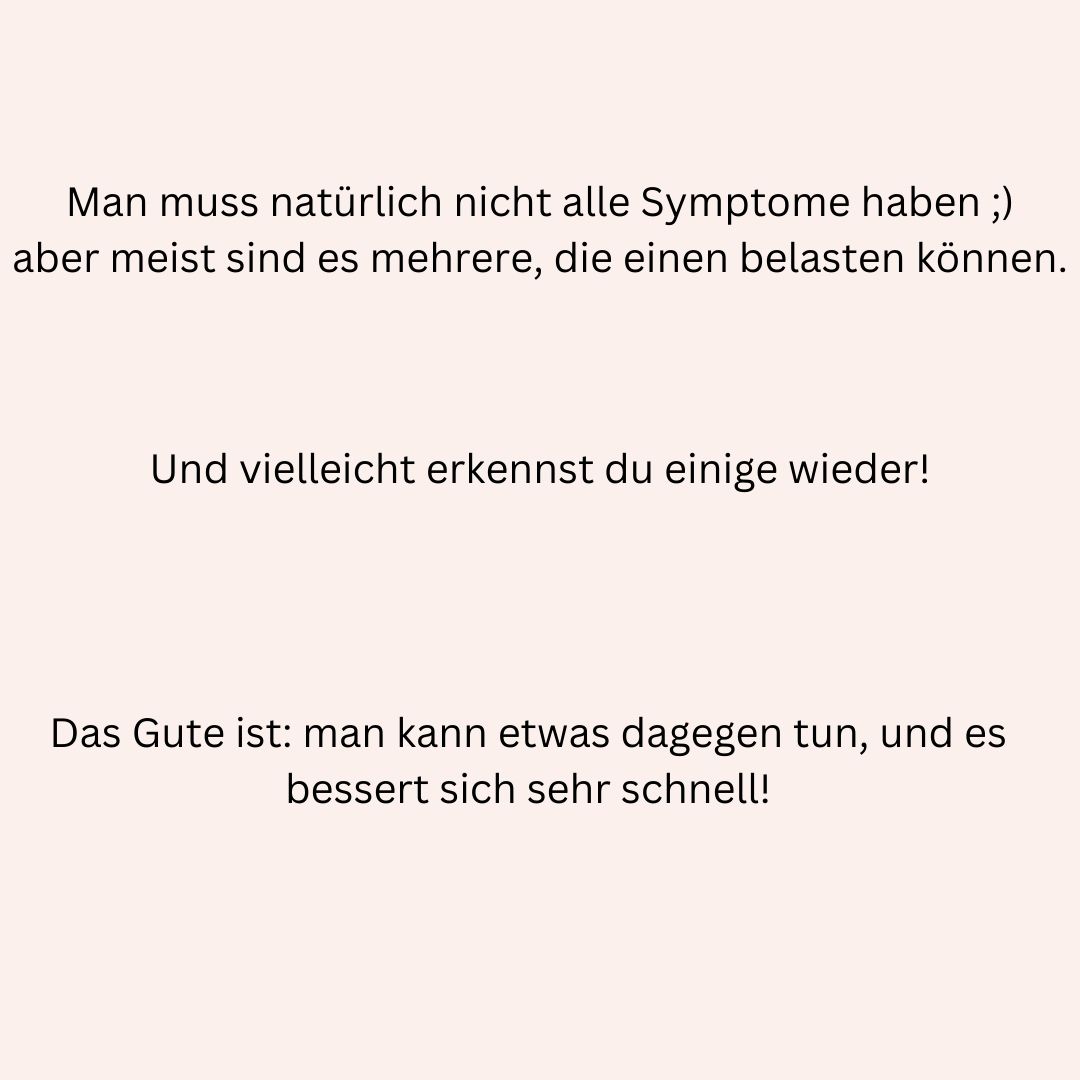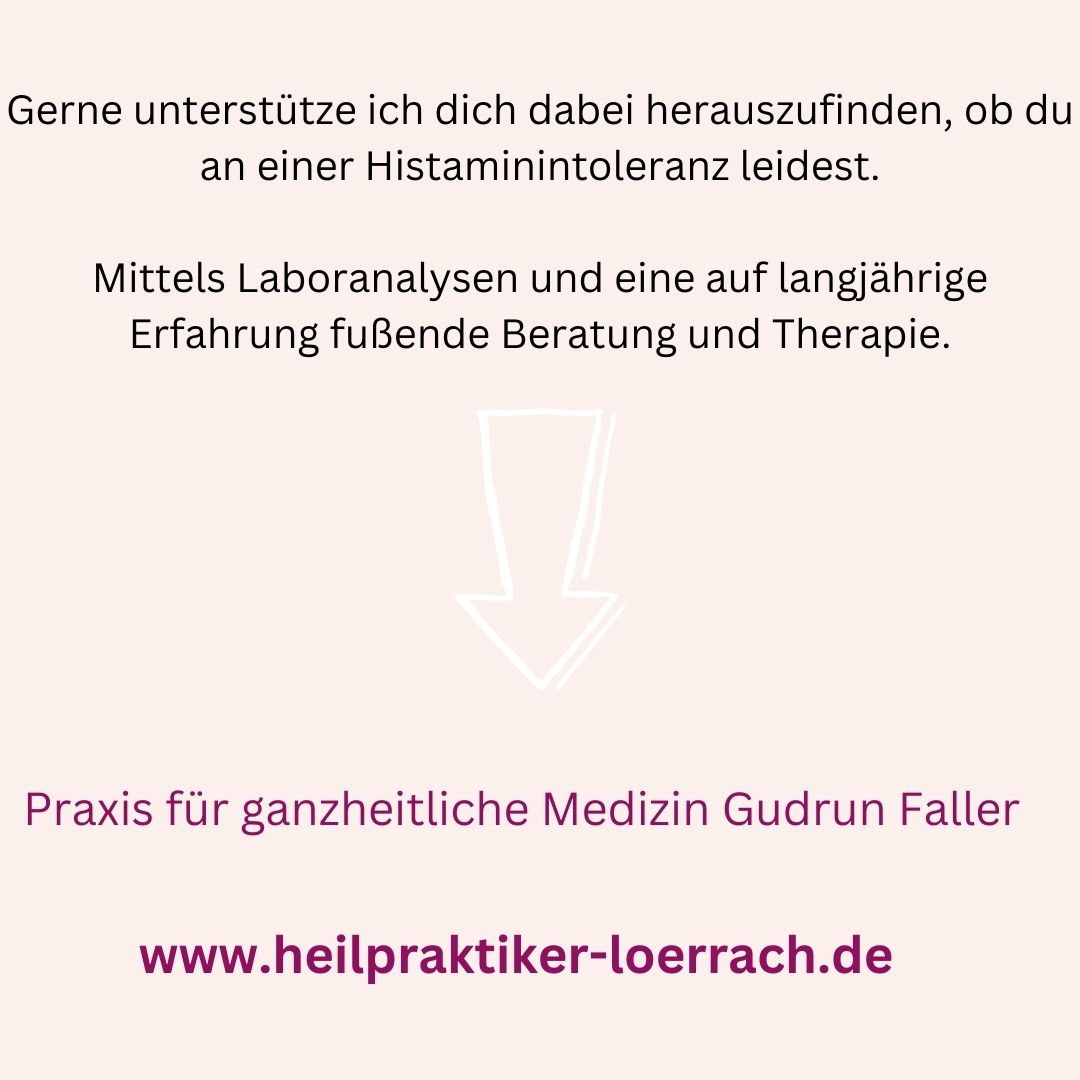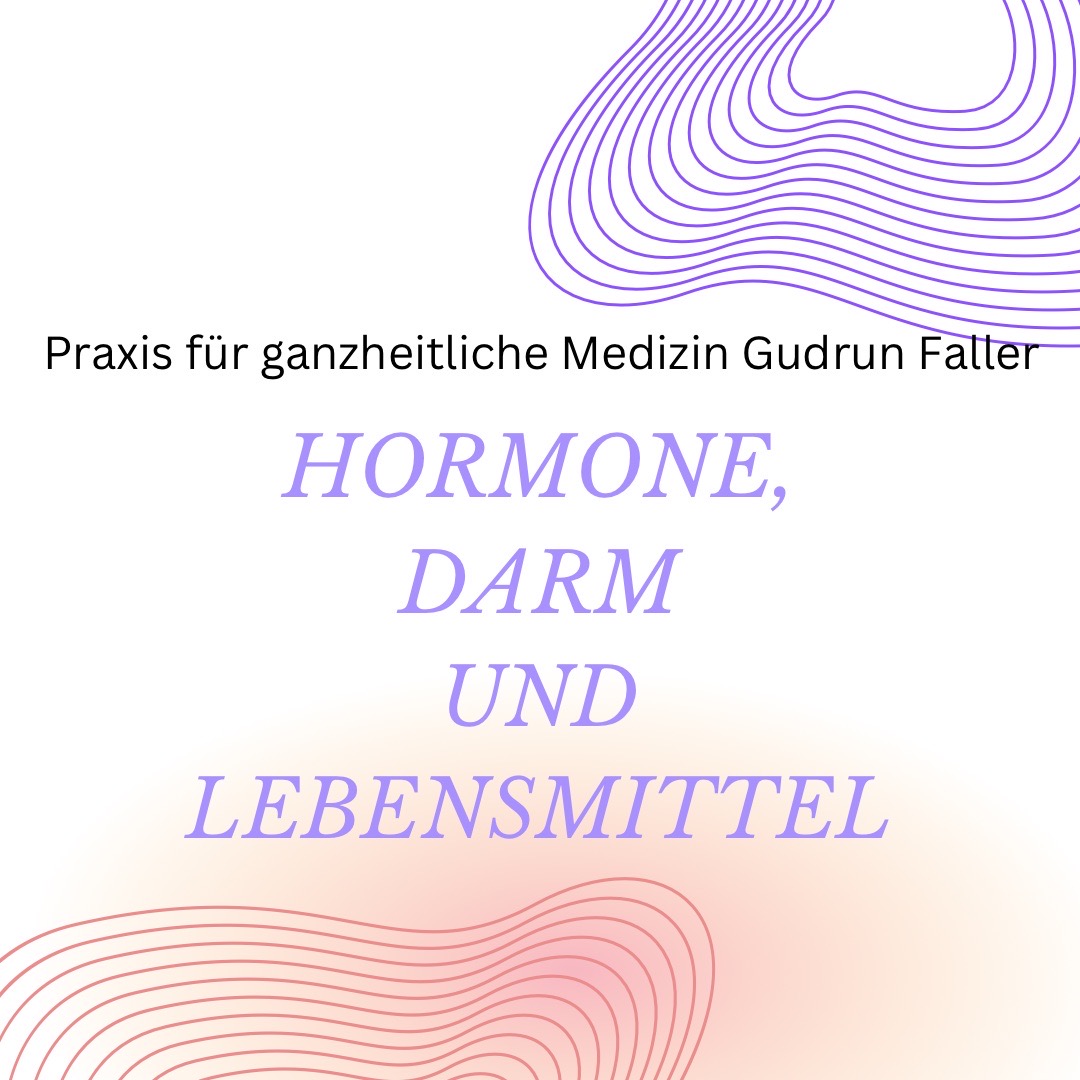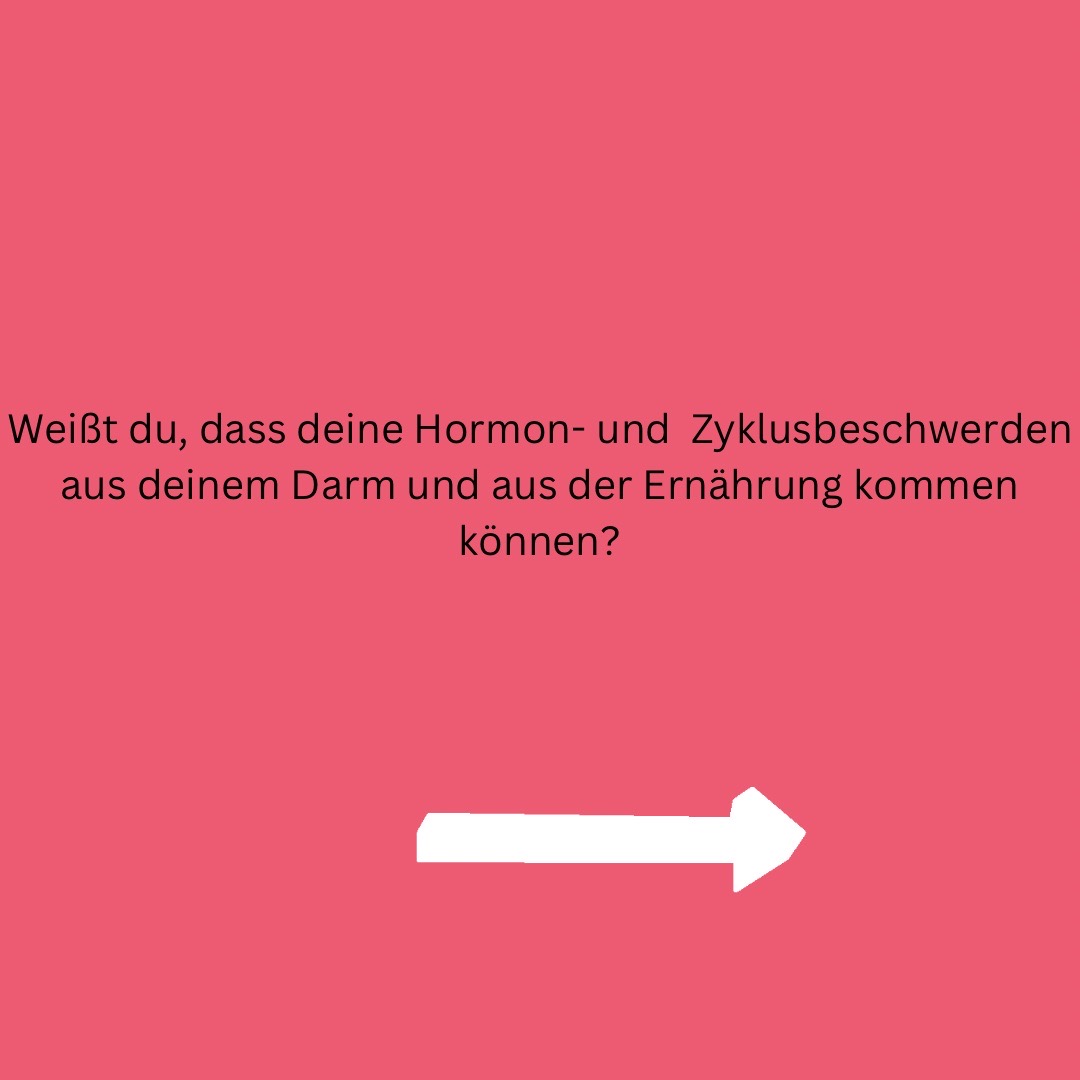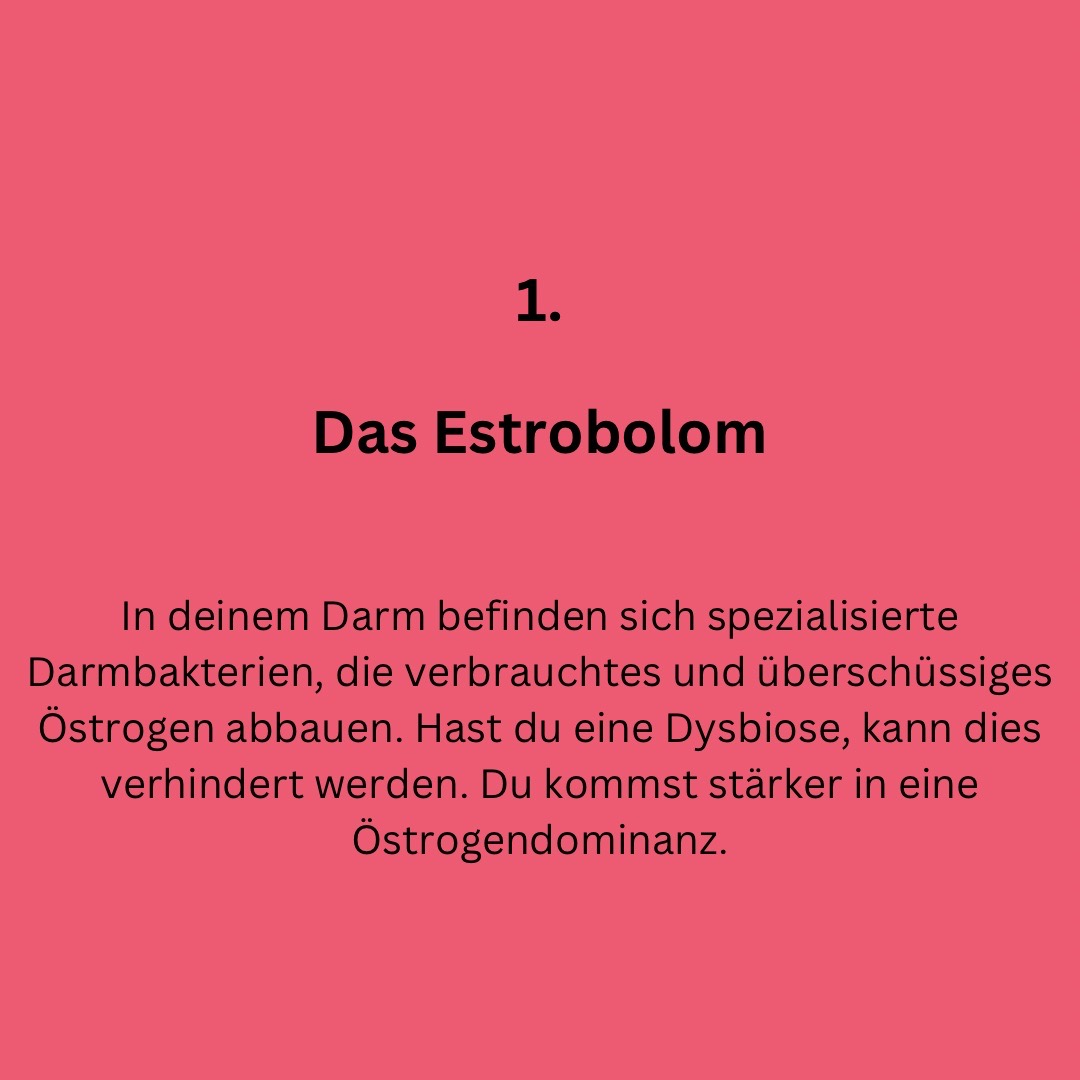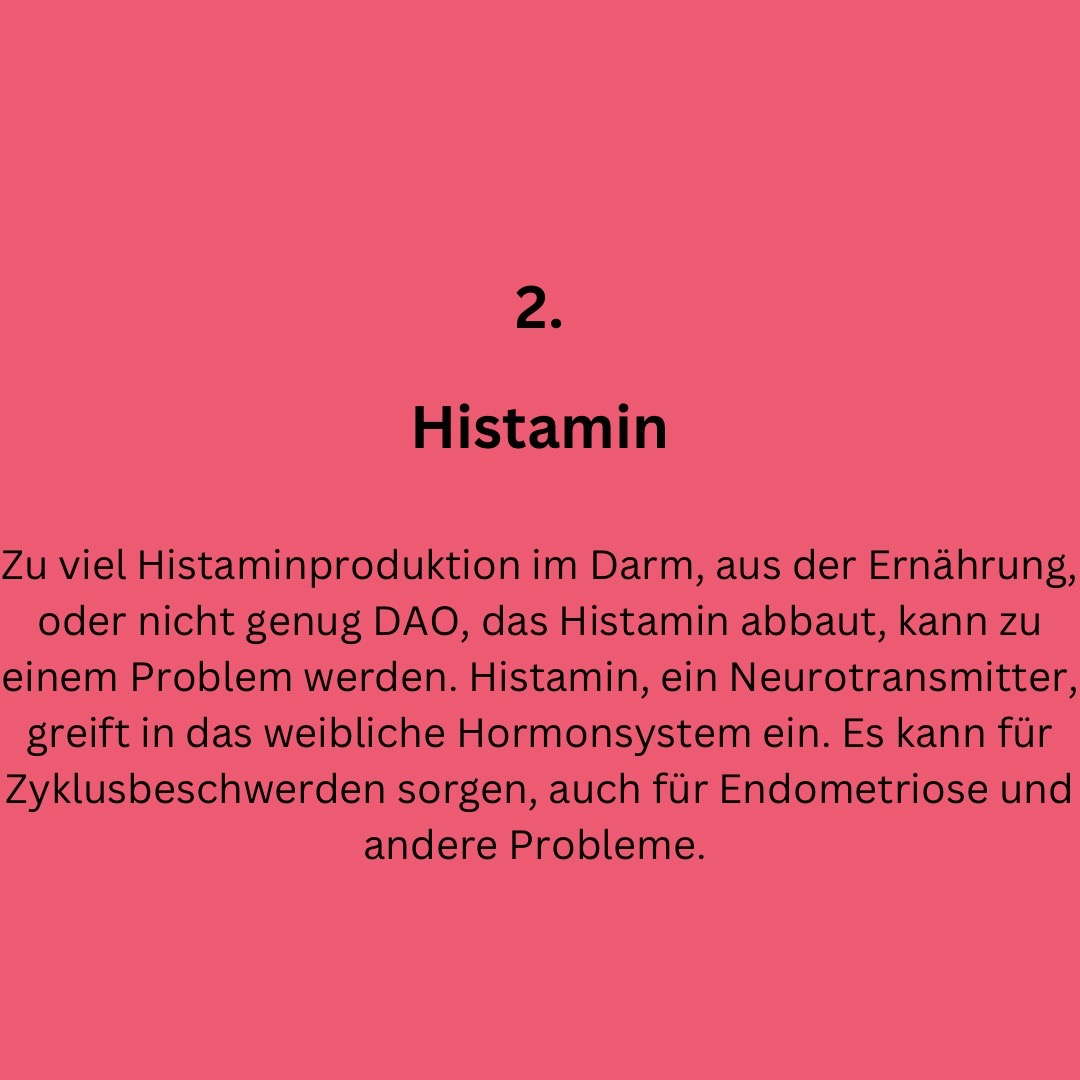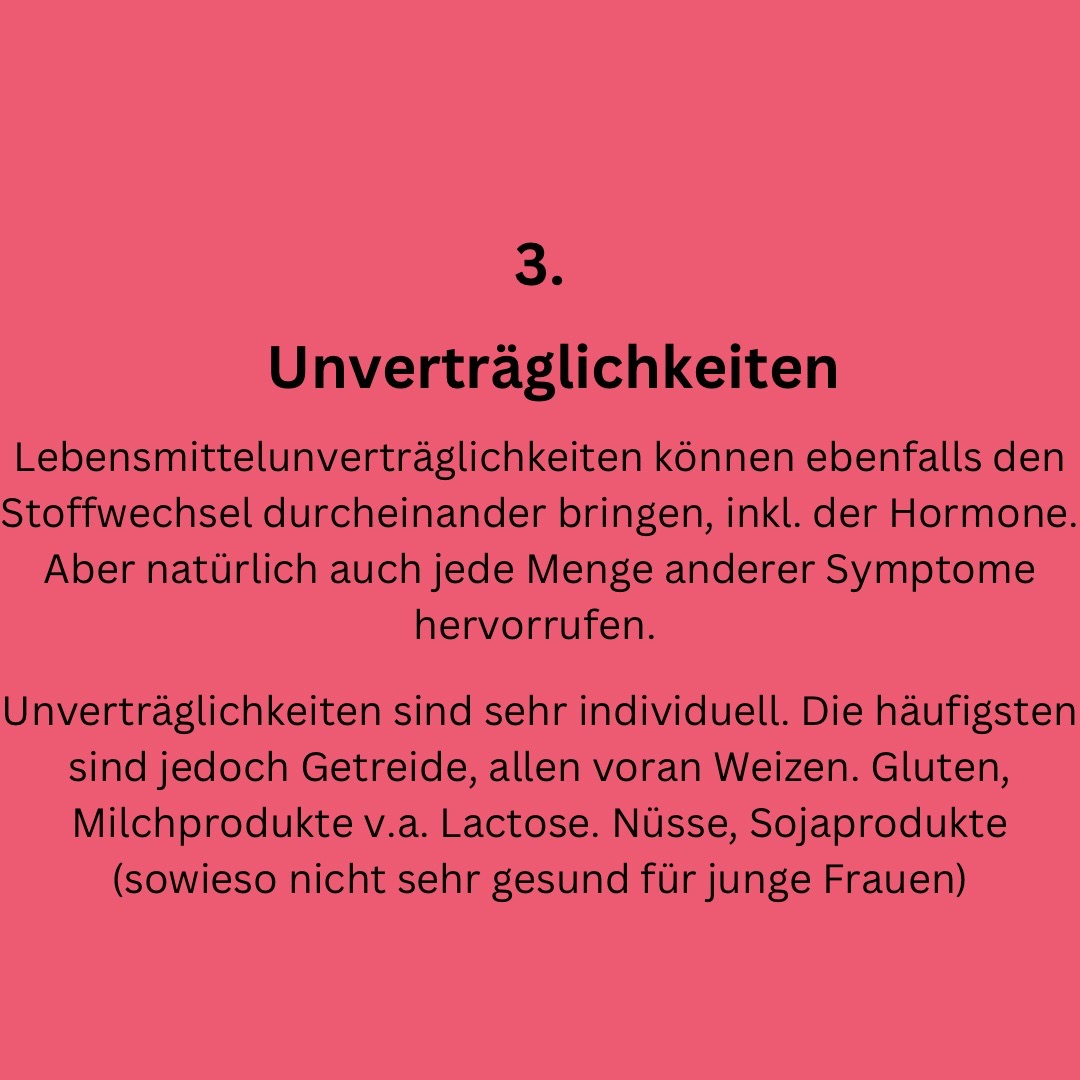Histamin
Reizdarm? Eine Verlegenheitsdiagnose?
01/11/25 10:25
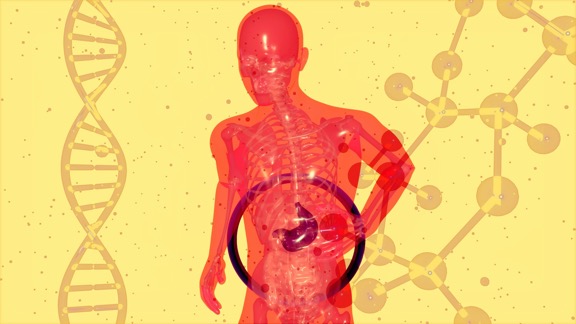
Reizdarm ist keine Erklärung – sondern oft eine Verlegenheitsdiagnose
„Sie haben Reizdarm.” Dieser Satz fällt in vielen Arztpraxen, auch hier in Lörrach, wenn Bauchschmerzen, Blähungen oder Durchfall nicht sofort einer klaren Ursache zugeordnet werden können. Für viele Betroffene fühlt sich diese Diagnose aber nicht wie eine Antwort an – sondern eher wie eine Sackgasse.
Du bist damit nicht allein. Und vor allem: Du musst dich nicht damit abfinden. Read More…
Burn out.
18/03/25 20:10
Burnout: Ursachen, Symptome, Diagnose und ganzheitliche Therapie
Burnout ist mehr als nur Erschöpfung – es ist ein Zustand tiefer körperlicher, emotionaler und mentaler Erschöpfung. Betroffene fühlen sich überfordert, antriebslos und häufig auch körperlich krank. Doch wie entsteht Burnout, wie erkennt man es, und welche ganzheitlichen Ansätze helfen bei der Behandlung? Read More…
Burnout ist mehr als nur Erschöpfung – es ist ein Zustand tiefer körperlicher, emotionaler und mentaler Erschöpfung. Betroffene fühlen sich überfordert, antriebslos und häufig auch körperlich krank. Doch wie entsteht Burnout, wie erkennt man es, und welche ganzheitlichen Ansätze helfen bei der Behandlung? Read More…
Histamin. Mastzellaktivierung
17/03/25 17:30
Histamin, Mastzellen und das Immunsystem: Wenn der Körper überreagiert
Histamin ist ein wichtiger Botenstoff im Körper, der viele Funktionen übernimmt – von der Immunabwehr bis zur Regulation der Magensäure. Doch bei manchen Menschen gerät die Histaminregulation aus dem Gleichgewicht, was zu vielfältigen Beschwerden führen kann. Besonders bei Allergien und Mastzellaktivierung spielt Histamin eine zentrale Rolle. Read More…
Histamin ist ein wichtiger Botenstoff im Körper, der viele Funktionen übernimmt – von der Immunabwehr bis zur Regulation der Magensäure. Doch bei manchen Menschen gerät die Histaminregulation aus dem Gleichgewicht, was zu vielfältigen Beschwerden führen kann. Besonders bei Allergien und Mastzellaktivierung spielt Histamin eine zentrale Rolle. Read More…